Die Fraktionen der SP und der Grünen begrüssen den Entscheid des Stadtrates, den aktuellen Bericht der Ombudsstelle zu veröffentlichen. Es ist aus unserer Sicht ein wichtiger Schritt hin zu mehr Transparenz und einer Entspannung der Lage, welchen wir honorieren. Bezugnehmend auf diesen Bericht bitten wir um die Beantwortung folgender Fragen:
Frage 1: Weiterbildungsseminare und Verhaltenskodex
Sutter/Baumann: Unter Punkt 4.3. heisst es: „Der Stadtrat hat mit Beschluss vom 5. Oktober 2017 aufgrund eines Zwischenberichtes der Ombudsstelle der Sozialbehörde empfohlen, Weiterbildungsseminare zu besuchen und einen Verhaltenskodex zu erarbeiten. Der Ombudsstelle ist nicht bekannt, was die Sozialbehörde in dieser Angelegenheit bis heute unternommen hat.“
Haben die Mitarbeitenden des Sozialamtes Weiterbildungsseminare besucht?
Sozialbehörde: Ja.
Sutter/Baumann: Wenn ja, welche?
Sozialbehörde: Alle Mitarbeitenden haben eine speziell angepasste Weiterbildung im Umfang von 1 1/2-Tagen (November 2017) zum Thema „Herausfordernde Persönlichkeiten/Persönlichkeitsstörungen und Psychotische Klientinnen in der Sozialhilfe“ durch die Hochschule Luzern Soziale Arbeit (HSL) besucht. Ausserdem werden durch die Mitarbeitenden laufend individuelle Weiterbildungen je nach Tätigkeitsbereich besucht.
Sutter/Baumann: Wurde durch die Sozialbehörde ein Verhaltenskodex ausgearbeitet?
Sozialbehörde: Nein.
Sutter/Baumann: Wenn nein, warum nicht?
Sozialbehörde: Soziale Gerechtigkeit und die Wahrung der Menschenwürde sind Grundlagen eines modernen Verständnisses von Sozialhilfe. Die Sozialhilfepraxis zeigt, dass die grosse Mehrheit der Hilfesuchenden nach Kräften mit den Sozialhilfeorganen zusammenarbeitet. ln diesem Sinn ist Sozialhilfe partnerschaftliche Hilfe, die individuell mit Respekt, adäquater Behandlung‘ und Professionalität an die Adresse der Hilfesuchenden erfolgt. Anmerkung der Grünen: Diese Passage wurde wortwörtlich aus den SKOS-Richtlinien abgeschrieben, ohne sie als Zitat zu deklarieren.
Flavia Sutter: Liebe Kolleginnen und Kollegen Gemeinderäte, lieber Stadtrat, geschätztes Publikum
Ich beginne mein Votum mit einem Rückblick, wie es (aus meiner Sicht) zur Schaffung einer Ombudsstelle kam in Dübendorf: Vor drei Jahren gelangte an die Öffentlichkeit, dass die Leiterin der Sozialhilfe Posts mit rechtsextremem Inhalt auf Facebook geteilt hatte. In den Medien wurde berichtet, dass ein rüder Ton herrsche auf dem Sozialamt und die Hilfesuchenden schikaniert werden.
Die Stadt Dübendorf stand plötzlich im Rampenlicht und was da an die Öffentlichkeit kam, war wenig schmeichelhaft. Zu diesem Zeitpunkt hätte der Stadtrat meiner Meinung nach reagieren müssen. Er hätte die Sache in aller Ruhe genau anschauen und untersuchen sollen. Auch personelle Konsequenzen wären nötig gewesen. Der Stadtrat machte weder das eine noch das andere, leider. Trotzdem aber sah er sich wegen des öffentlichen Drucks gezwungen, etwas zu unternehmen und schaffte eine Ombudsstelle. Im Dezember 2016 übernahm Anton Frauenfelder die Stelle als Ombudsmann der Stadt Dübendorf.
Kleiner Einschub: Anton Frauenfelder ist seit 2011 Ombudsmann in Wallisellen und hat bis zu seiner Pensionierung über 30 Jahre als Gemeindeschreiber in Rümlang gearbeitet.
Noch ein kleiner Einschub: Eine Ombudsstelle bietet kostenlose, neutrale und unabhängige Hilfe bei Problemen mit der Stadtverwaltung, sie steht auch den städtischen Mitarbeitenden bei Konflikten am Arbeitsplatz zur Verfügung.
Die Schaffung dieser Stelle war sicher ein vernünftiger Schritt, insbesondere wegen der vielen Klagen betreffend das Sozialamt. Die Jahresberichte des Ombudsmannes wollte der Stadtrat zuerst nicht veröffentlichen, trotz Nachfragens von verschiedenen Seiten. Dies weckte unser Misstrauen. Was der Stadtrat wohl zu verbergen hat, wenn er die Berichte nicht veröffentlichen will? Schlussendlich veröffentlichte er die Berichte 2017 und 2018 doch noch, im Frühling dieses Jahres. Allerdings existiert ein Zusatzbericht zum Bericht 2018, der nach wie vor nicht öffentlich ist. Es zeigte sich dann, dass der grosse Teil der Anliegen tatsächlich aus dem Ressort Soziales kamen. Gemäss Jahresbericht betrafen im Jahr 2017 44 von 61 Anfragen das Sozialamt, 2018 waren es 21 von 31, die Zahlen aus dem Zusatzbericht nicht mitgezählt.
Bis anhin war der Ombudsmann dem Stadtrat unterstellt, was unüblich ist. In Zürich und Winterthur ist die Ombudsstelle dem Gemeinderat unterstellt. Das heisst, er (oder sie) gibt den Bericht jeweils zuhanden des Gemeinderates ab. Für unseren Ombudsmann war die Zusammenarbeit mit dem Stadtrat und der Sozialbehörde offenbar sehr mühsam. Da seine Stelle innert kürzester Frist als Notfallmassnahme geschaffen wurde, ist sie rechtlich nicht verbindlich geregelt. Allerdings gibt es gesetzliche Grundlagen, welche beschreiben, dass eine Ombudsstelle unabhängig von der Stadtverwaltung arbeite und dem Parlament Rechenschaft geben soll. Die Verwaltung habe die Pflicht, bei konkreten Anfragen dem Ombudsmann Einsicht zu gewähren in die betreffenden Dokumente und Prozessabläufe. Unser Ombudsmann, Herr Frauenfelder, musste für all diese rechtlichen und strukturellen Bedingungen, welche die Erfüllung seiner Aufgaben erfordern, kämpfen. Es ist gelungen, die internen Abläufe zu verbessern, jedoch blieb ihm die Akteneinsicht für Fälle, welche das Sozialamt betreffen, öfters verwehrt. Schliesslich hat er sich Mitte dieses Jahres entschlossen, dem Gemeinderatsbüro Rechenschaft über seine Arbeit abzulegen. Denn er wolle fortan dem Gemeinderat unterstellt sein, und nicht mehr dem Stadtrat. Auf längere Frist könne er seine Arbeit nur unter diesen Voraussetzungen wahrnehmen. Es gebe verschiedene Hindernisse, welche seine Arbeit erschwerten, zum Beispiel, dass er kein Fachpersonal habe beiziehen dürfen, wenn er etwas fachlich habe klären wollen.
Die Untersuchung, die nach erneuten Medienberichten in diesem Februar vom Stadtrat eingeleitet wurde, wollte dieser zuerst vom Abteilungsleiter Soziales durchführen lassen. Auf Herrn Frauenfelders Hinweis, sie könnten nicht sich selber untersuchen, haben sie eine Firma dafür engagiert. Seltsamerweise eine Firma, die spezialisiert ist auf finanztechnische Prüfungen. Auf Geheiss des Stadtrats und der Sozialbehörde hatte Herr Frauenfelder keinen Kontakt mit der Person, welche die externe Untersuchung leitete.
Kurz gesagt, der Ombudsmann wurde massiv in seiner Arbeit behindert. Nun konnten Gemeinde- und Stadtrat sich darauf einigen, dass der Ombudsmann provisorisch dem Gemeinderat untersteht und dem Büro Bericht erteilt. Eine Unterkommission der GRPK arbeitet zurzeit einen Vorschlag zuhanden des GR aus, wie die Ombudsstelle für Dübendorf definitiv und langfristig in der Gemeindeordnung verankert werden kann.
Nun komme ich zur Stellungnahme zu den Antworten zu unserer Interpellation. Wir bedanken uns beim Stadtrat und der Sozialbehörde für die rechtzeitige Beantwortung unserer Fragen.
Ich werde zu den Antworten auf die Fragen 2 und 4 Stellung nehmen, Hanna Baumann zu den Antworten 1 und 3.
Hanna Baumann: Liebe Kolleginnen und Kollegen Gemeinderäte, lieber Stadtrat, geschätztes Publikum
Auch ich bedanke mich für die gewissenhafte und rechtzeitige Beantwortung unserer Fragen zum Ombudsbericht 2018 und nehme Stellung zur ersten und dritten Frage unserer Interpellation.
Bei der ersten Frage wollten wir vom Stadtrat wissen, ob gemäss ihrem Beschluss vom 5. Okt. 2017 die Empfehlungen des Ombudsmannes, dass die Mitarbeitenden Weiterbildungen besuchen und einen Verhaltenskodex erarbeiten, inzwischen umgesetzt worden ist. Wir erfahren in der Antwort, dass bereits im November 2017 alle Mitarbeitenden eine Weiterbildung von anderthalb Tagen zum Thema „Herausfordernde Persönlichkeiten/ Persönlichkeitsstörungen und psychotische Klientinnen und Klienten in der Sozialhilfe“ absolviert haben. Und dass die Mitarbeitenden zudem laufend individuelle Weiterbildungen besuchten, die in ihrem Tätigkeitsbereich hilfreich sind.
Hingegen wurde leider kein Verhaltenskodex erarbeitet. In der Erläuterung zu dieser Frage werden die SKOS-Richtlinien zitiert, dort heisst es, soziale Gerechtigkeit und die Wahrung der Menschenwürde gehöre zu den Grundlagen eines modernen Verständnisses von Sozialhilfe, wobei die meisten Hilfesuchenden nach Kräften mit den Sozialhilfeorganen zusammenarbeite. Es erstaunt, dass in dieser Antwort das Verhalten der Hilfesuchenden in den Fokus gerät, während sich ein Verhaltenskodex doch primär auf das Verhalten der Angestellten richten würde. Ein solcher Verhaltenskodex dient als Hilfsmittel, damit Mitarbeitende auch in Stresssituationen und gegenüber herausfordernden Klientinnen und Klienten deren Menschenwürde besser wahren und respektvoll mit ihnen umgehen können. Nach wie vor finden wir die Erarbeitung eines Verhaltenskodex unabdingbar, um den Umgangston und das professionelle Handeln auf der Abteilung Sozialhilfe zu fördern und zu stärken.
Frage 2: Persönliche Hilfe und Zusammenarbeit mit anderen Sozialdiensten
Sutter/Baumann: Unter Punkt 4.4. heisst es: „Der Stadtrat hat mit Beschluss vom 5. Oktober 2017 der Sozialbehörde empfohlen, das Angebot der persönlichen Hilfe zu definieren und zu kommunizieren. Der Ombudsstelle ist nicht bekannt, ob die Sozialbehörde in dieser Hinsicht Schritte eingeleitet hat (z.B. Unterstützung bei der Suche einer neuen Wohnung) und ob allenfalls eine engere Zusammenarbeit mit den Sozialdiensten der Schule, der ref. und kath. Kirche in die Wege geleitet wurden.“
Wurde das Angebot der persönlichen Hilfe definiert?
Sozialbehörde: Ja gemäss Gesetzesvorlage SHG (Schweizerisches Sozialhilfegesetz). Die persönliche Hilfe ist an kein bestimmtes Verfahren gebunden. Auch die persönliche Hife richtet sich nach den Besonderheiten und Bedürfnissen des Einzelfalls. Die persönliche Hilfe wird im Einvernehmen mit der oder dem Hilfesuchenden gewährt. Gegen den Willen der betroffenen Person dürfen also keine Massnahmen getroffen werden. Durch die persönliche Hilfe wird ihr Selbstbestimmungsrecht nicht eingeschränkt. Die Hilfeleistung kann zwar angeboten, sie darf aber nicht aufgezwungen werden. Ebenso berücksichtigt sie die eigenen Möglichkeiten der Klientschaft, andere gesetzliche Leistungen sowie die Beratung und Betreuung durch Dritte. lnsofern hat sie ergänzenden Charakter, wobei sie nicht davon abhängig gemacht werden darf, dass die Klientschaft zuerst private Hilfsquellen ausschöpft. Wichtig ist, dass auch die persönliche Hilfe in Zusammenarbeit mit der Klientschaft erfolgt und deren Selbsthilfe fördert. Persönliche Hilfe wird unentgeltlich geleistet. Die Beratungs- und Betreuungsstelle ist jedoch nicht verpflichtet, eine über die gewöhnliche Beratung hinausgehende Hilfeleistung zu übernehmen, für welche die oder der Hilfesuchende selbst aufkommen kann. Das Gesetz verschafft keinen Anspruch auf uneingeschränkten Zugang der Hilfe. Persönliche Hilfe muss nur soweit gewährt werden, als sie wirklich notwendig erscheint. Das gilt auch in finanzieller Hinsicht. Hilfeleistungen, für die die Hilfesuchenden selbst aufkommen können, müssen nicht unentgeltlich angeboten werden. Dies deckt sich mit dem Grundsatz der Subsidiarität der Sozialhilfe. Liegt also keine wirtschaftliche Notlage vor, so haben die Hilfesuchenden für die Kosten der ihnen vermittelten Beratungs- und Betreuungsdienste Dritter selber aufzukommen. Liegt hingegen nicht nur eine persönliche, sondern gleichzeitig auch eine wirtschaftliche Notlage vor, so wird der Antrag auf wirtschaftliche Hilfe geprüft. Spezielle Betreuungs- und Beratungsdienste Dritter können so auch zum Gegenstand wirtschaftlicher Hilfe werden. Erachtet die Sozialbehörde eine spezielle Betreuung von Seiten Dritter als sinnvoll und notwendig, so leistet sie für solche Dienste im Rahmen der wirtschaftlichen Hilfe Kostengutsprache. Das Angebot der persönlichen Hilfe in der Stadt Dübendorf richtet sich nach diesen Grundsätzen.
Sutter/Baumann: Wenn ja, werden die Klient*innen über Art und Umfang informiert?
Sozialbehörde: Bei den Klienten fliesst die persönliche Hilfe in die wirtschaftliche Hilfe ein. Bei Personen welche keine Klienten sind, wird je nach Anliegen abgeklärt, ob persönliche Hilfe zum Tragen kommt und ob die betroffenen dies überhaupt wollen. lst persönliche Hilfe angezeigt wird die Person informiert. Eine Beratung kann z.B. die Besprechung der Situation und Aufzeigung der Lösungsmöglichkeiten, lnformation über soziale Leistungen, rechtliche Möglichkeiten und Herausgabe von Formularen, Adressen (je nach Problematik) beinhalten. Wenn es notwendig erscheint, wird auch mal ein Termin bei unseren Jobcoaches oder ein Entlastungsgespräch bei unserem Psychologen angeboten. Dabei kann es sich neben Beratung auch um materielle Hilfe handeln, wenn dadurch eine Notlage abgewendet werden kann oder zur Stabilisierung. Das Sozialamt Dübendorf arbeitet auch mit anderen Stellen zusammen, z.B. Schuldenberatung Kanton Zürich, BVZ, Pro lnfirmis, Familienbegleitung etc.
Sutter/Baumann: Ist der Stadtrat bereit, Informationen zu Art und Umfang der persönlichen Hilfe öffentlich zugänglich zu machen?
Sozialbehörde: Auf der Website der Stadt Dübendorf wird unter der Rubrik Sozialhilfe auf die persönliche Hilfe hingewiesen.
Sutter/Baumann: Wurden Schritte eingeleitet, um die Zusammenarbeit mit anderen Sozialdiensten wie jenem der Schule oder der Landeskirchen zu verbessern?
Sozialbehörde: Besondere Schritte wurden nicht eingeleitet. Bei Schnittpunkten kann man jederzeit aufeinander zugehen.
Sutter/Baumann: Wenn nein, warum nicht?
Sozialbehörde: Bei Schnittpunkten kann man jederzeit aufeinander zugehen.
Flavia Sutter: In Frage 2 geht es um die „Persönliche Hilfe“. Vor drei Jahren habe ich schon eine Interpellation gemacht zu diesem Thema. Schon damals beklagten verschiedene Sozialarbeitende in Dübendorf, u.a. von kirchlichen, kantonalen und unabhängigen Sozialdienst-Stellen, dass Dübendorf keine persönliche Hilfe leiste. Wir sprechen hier von Beratung und Hilfe zur Selbsthilfe ausserhalb der wirtschaftlichen Hilfe. Das Sozialamt ist per Gesetz verpflichtet, diese Hilfe anzubieten. Der Stadtrat empfiehlt der Sozialbehörde gemäss Bericht des Ombudsmannes, das Angebot der persönlichen Hilfe zu definieren und zu kommunizieren. Das ist offenbar nicht geschehen.
Die Sozialbehörde liefert in ihrer Antwort auf unsere Frage eine ausführliche Definition des Begriffes der ‚persönlichen Hilfe‘. Uns interessiert jedoch, wie Ratsuchende über ihre Möglichkeiten informiert werden.. Die öffentliche Information zum Angebot der persönlichen Hilfe beschränkt sich auf einen Hinweis in einem Nebensatz auf der Homepage der Stadt Dübendorf unter der Rubrik Sozialhilfe. Auf den Homepages von umliegenden Gemeinden, zum Beispiel Wallisellen und Kloten, ist „persönliche Hilfe“ ein eigener Begriff und wird besser erklärt und ausformuliert.
Es sind keine besonderen Schritte eingeleitet worden, um die Zusammenarbeit mit Sozialdiensten von Dübendorfer Institutionen wie der Schulsozialarbeit oder der Sozialdienste der beiden Landeskirchen zu verbessern. Dies ist bedauerlich, da es wohl die nachhaltigste Möglichkeit wäre, das Angebot persönliche Hilfe innerhalb von Dübendorf zu gewährleisten. Die KoSoDü (Koordination Soziale Arbeit Dübendorf), eine locker organisierte Arbeitsgruppe von Leuten, die im sozialen Bereich arbeiten, gibt es seit ca. einem Jahr nicht mehr. Leute aus der KoSoDü wollten Lücken aufdecken im Sozialamt, haben recherchiert und sind beim Sozialamt vorstellig geworden mit ihren Resultaten. Dies kam offenbar nicht gut an, im Gegenteil. Die eigenen Mitarbeitenden durften daraufhin nicht mehr an den KoSoDü-Sitzungen teilnehmen, auch die Schulsozialarbeiter, die sich über die Schule hinaus vernetzen wollten, wurden zurückgepfiffen. Schade um diese verpassten Chancen, sich zu vernetzen.
Frage 3: Unangemeldete Hausbesuche
Sutter/Baumann: Und weiter: „In einem Abklärungsauftrag hat die Ombudsstelle auf die Problematik von unangemeldeten Hausbesuchen hingewiesen. Es stellen sich in dieser Hinsicht Fragen wie: aufgrund welcher gesetzlicher Grundlagen werden solche Kontrollen durchgeführt, wie oft finden solche Kontrollen statt, aus welchen Gründen werden Kontrollen nicht angemeldet usw. Ob die Sozialbehörde in dieser Hinsicht einen Prozessablauf erarbeitet hat, ist der Ombudsstelle nicht bekannt.“
Aufgrund welcher gesetzlichen Grundlagen führt das Sozialamt unangemeldete Hausbesuche durch?
Sozialbehörde:Verwaltungsrechtspflegegesetz: (Anmerkung der Grünen: Art. 7 Untersuchung von Amtes wegen) Die Verwaltungsbehörde untersucht den Sachverhalt von Amtes wegen durch Befragen der Beteiligten und von Auskunftspersonen, durch Beizug von Amtsberichten, Urkunden und Sachverständigen, durch Augenschein oder auf andere Weise. Die am Verfahren Beteiligten haben dabei mitzuwirken: a) soweit sie ein Begehren gestellt haben, b) wenn ihnen nach gesetzlicher Vorschrift eine Auskunfts- oder Mitteilungspflicht obliegt.
Sozialhilfegesetz: (Anmerkung der Grünen: Art. 18, Stellung des Hilfesuchenden) Der Hilfesuchende gibt vollständig und wahrheitsgetreu Auskunft über:
a. seine finanziellen Verhältnisse im ln- und Ausland, namentlich auch über Ansprüche gegenüber Dritten,
b. die finanziellen Verhältnisse von Angehörigen, die mit ihm zusammenleben oder ihm gegenüber unterhalts- oder unterstützungspflichtig sind,
c. die finanziellen Verhältnisse von anderen Personen, die mit ihm zusammenleben, soweit die Auskunft für die Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben der Sozialhilfe geeignet und erforderlich ist,
d. seine persönlichen Verhältnisse und diejenigen der in lit. b und c genannten Personen, soweit die Auskunft für die Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben der Sozialhilfe geeignet und erforderlich ist.
2 Der Hilfesuchende gewährt Einsicht in seine Unterlagen, soweit dies für die Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben der Sozialhilfe geeignet und erforderlich ist.
3 Der Hilfesuchende meldet unaufgefordert Veränderungen der unterstützungsrelevanten Sachverhalte.
4 Die Fürsorgebehörde ist berechtigt, auch ohne Zustimmung des Hilfesuchenden und der weiteren in Abs. 1 genannten Personen Auskünfte bei Dritten einzuholen, die sie für die Erfüllung ihrer Aufgaben benötigt, wenn Zweifel an der Richtigkeit oder Vollständigkeit der Angaben oder Unterlagen bestehen.
5 Die Fürsorgebehörde informiert den Hilfesuchenden und die weiteren in Abs. 1 genannten Personen in der Regel vorgängig über Auskünfte, die über sie eingeholt werden. ln Fällen von Abs. 4 kann die lnformation auch nachträglich erfolgen.
Die beauftragte Drittperson muss sich an die datenschutzrechtlichen Vorgaben und insbesondere an die Schweigepflicht halten. Die Abklärung muss verhältnismässig erfolgen, lm Sozialhilfeantrag wird vorgehend informiert, dass die gemachten Angaben mittels Hausbesuche durch dafür beauftragte Personen überprüft werden können.
Sutter/Baumann: Aus welchen Gründen und durch wen werden diese Kontrollen durchgeführt?
Sozialbehörde: lm Bereich Sozialhilfe ist es die Aufgabe des Sozialamtes abzuklären, ob eine Person tatsächlich einen rechtlichen Anspruch auf Unterstützung hat. Dabei ist es wesentlich zu wissen, ob der angegebene Wohnsitz korrekt ist, die Grösse der Unterstützungseinheit stimmt und ob die Angaben zur Einkommens- und Vermögenssituation den Tatsachen entsprechen. Eine grosse Fallbelastung verunmöglicht aber oftmals Abklärungen in der Privatwohnung, in allfälligen Geschäftsräumlichkeiten, in Garagen und Abstellplätzen. Durch den Einsatz von dazu beauftragten und geeigneten Drittpersonen können gezielt umfassende und nach einem festgelegten Ablauf erfasste Erkenntnisse zur Situation gewonnen werden. Sozialinspektoren überprüfen, ob die von einer Sozialhilfebeziehenden Person gemachten Angaben zutreffend sind. Es bleibt der Sozialhilfe auch oftmals jahrelang verborgen, in welcher Situation jemand oder eine Familie lebt, gegen aussen wird so aufgetreten, dass niemand bemerkt was los ist. Oftmals werden solche Situationen erst bei einem Sanitätseinsatz oder bei Verlust der Wohnung bekannt. So können allfällige Missstände allenfalls früher entdeckt und eine bedarfsgerechte Hilfe in die Wege geleitet werden.
Die Kontrollen werden durch erfahrene Sozialinspektoren durchgeführt, die solche Hausbesuche auch für andere Gemeinden (Sozialdienste) durchführen.
Sutter/Baumann: Wie oft finden diese Kontrollen statt?
Sozialbehörde: ln der Regel einmal, ausser die Situation erfordert weitere Besuche (oft wurde festgestellt, dass sich die Person gar nicht an der gemeldeten Adresse aufhält) oder es müssen aus Verdachts- oder Revisionsgründen Sachverhaltsabklärungen gemacht werden.
Sutter/Baumann: Aus welchen Gründen erfolgen die Kontrollen unangemeldet?
Sozialbehörde: Sachverhaltsabklärungen machen angemeldet keinen Sinn, weitere Personen sind sonst nicht anwesend, Vermögenswerte welche nicht mehr da sind, Namen werden entfernt usw. Der Zutritt erfolgt nur bei schriftlicher Zustimmung.
Sutter/Baumann: Hat die Sozialbehörde diesbezüglich einen Prozessablauf erarbeitet?
Sozialbehörde: Der Entscheid, ob ein Hausbesuch erfolgt, ist vom jeweiligen Einzelfall abhängig. Massgebend dafür sind Zweifel oder Unklarheiten bei den Angaben oder der Situation der Klienten, teilweise auch deren Verhalten oder ein bestehender Verdacht, der Anlass für weitere Abklärungen gibt. Ein schriftlicher Prozessablauf besteht dafür bislang nicht, wird jedoch als QMS-Pendenz aufgenommen.
Hanna Baumann: Unsere dritte Frage bezieht sich auf die Rechtmässigkeit von unangemeldeten Hausbesuchen. In der Antwort wird Bezug genommen zum Verwaltungsrechtspflegegesetz und zum Sozialhilfegesetz im Sinne von: in Zweifelsfällen sei eine Untersuchung von Amtes wegen angezeigt, um zu prüfen, ob die gemachten Angaben zu Adresse, Einkommensverhältnissen u.ä. korrekt seien. Unter gegebenen Umständen könnten Hausbesuche auch unangemeldet durchgeführt werden, da sonst die Gefahr einer Verfälschung der Tatsachen vorliege. Im Sozialhilfegesetz steht auch, die Abklärung müsse verhältnismässig und durch geeignete Personen erfolgen. In Dübendorf seien Sozialdetektive im Einsatz. Bisher gebe es keinen schriftlichen Prozessablauf für den Einsatz von Sozialdetektiven, doch das werde neu als Pendenz im Qualitäts-Management-System geführt. Wir begrüssen es, dass unsere Frage in dem Sinne ernstgenommen wird, und hoffen, dass die Pendenz bald abgebaut wird. Dazu geben wir gerne noch folgende Überlegung mit auf den Weg:
Ist es verhältnismässig und nötig, dass eine alleinerziehende Mutter oder eine alleinstehende Frau von zwei Männern heimgesucht wird, wenn sie sich beim Sozialamt anmeldet? Die Schilderungen von Betroffenen, die ich als Sozialdiakonin zu hören bekam, zeigte mir jedenfalls, dass die Frauen ob dem Erscheinen der Sozialdetektive an ihrer Haustüre ordentlich erschrocken sind. Mir scheint, es wäre angemessener, in solchen Fällen den Gender-Aspekt zu berücksichtigen, und für die Abklärung wenigstens auch eine Sozialdetektivin zu beauftragen. Bei der gängigen Praxis könnten sonst Traumata von Missbrauchserfahrungen reaktiviert und die Frau psychischen Belastungen ausgesetzt werden, was nur schadet und niemandem dient.
Frage 4: Zusatzbericht
Sutter/Baumann: Im Stadtratsbeschluss vom 11.04.2019 ist festgehalten, dass der Leiter der Ombudsstelle einen Zusatzbericht erstellt hat, datiert mit dem 26. März 2019. Dieser Bericht solle Bestandteil der laufenden internen Abklärungen der Abteilung Soziales sein und bis auf Weiteres nicht öffentlich gemacht werden (Beschluss Nr.3 im Protokoll vom 11.04.2019).
Aus welchen Gründen bleibt der Zusatzbericht der Abteilung Soziales vorbehalten?
Sozialbehörde: Der Zusatzbericht enthält Angaben zu Einzelpersonen, weshalb dieser zut Wahrung des Persönlichkeitsschutzes nicht veröffentlicht werden kann.
Sutter/Baumann: Wie werden die Meldungen von Mitarbeitenden der Sozialhilfe in den Prozess der internen Abklärungen einbezogen?
Sozialbehörde: Durch Befragungen der einzelnen Mitarbeitenden.
Flavia Sutter: In der vierten Frage wollten wir vom Stadtrat wissen, warum der Zusatzbericht zum Jahresbericht 2018, welcher den Beginn des laufenden Jahres betrifft, der Abteilung Soziales vorbehalten bleibt. Der Stadtrat schreibt, dass der Zusatzbericht Angaben zu Einzelpersonen enthalte, weshalb dieser zur Wahrung des Persönlichkeitsschutzes nicht veröffentlicht werden könne. Die Mitglieder der GRPK konnten unterdessen vertraulich Einblick in den Zusatzbericht nehmen. Ich gehöre da nicht dazu, ich habe aber gehört, dass gar keine Namen in dem Zusatzbericht stehen. Schon die Jahresberichte 2017 und 2018 hat der Stadtrat nicht veröffentlicht mit dieser Begründung. Und konnte diese Berichte jetzt ja trotzdem öffentlich machen. Dieses Vorgehen wirkt seltsam und erweckt den Eindruck, dass der Stadtrat etwas verbergen will.
Besten Dank für die Aufmerksamkeit – an dieser Stelle übergebe ich nun das Wort an Hanna Baumann.
Hanna Baumann: Gemäss unserer Einschätzung liegt in der Abteilung Soziales immer noch vieles im Argen. Es gibt nach wie vor keinen Verhaltenskodex, persönliche Hilfe findet ausserhalb der wirtschaftlichen Hilfe nicht statt, unangemeldete Hausbesuche sind ein gängiges, kaum hinterfragtes Instrument.
Ob der Ombudsmann in Zukunft seiner Arbeit nachgehen kann und die benötigten Auskünfte und Unterlagen erhält, wird sich in nächster Zeit zeigen. Wir begrüssen es, dass es eine Ombudsstelle gibt, und dass der Ombudsmann neu dem Gemeinderat unterstellt ist und plädieren dafür, dies auch so in der Gemeindeordnung zu verankern.
Flavia Sutter, Gemeinderätin Grüne, Hanna Baumann, Gemeinderätin SP



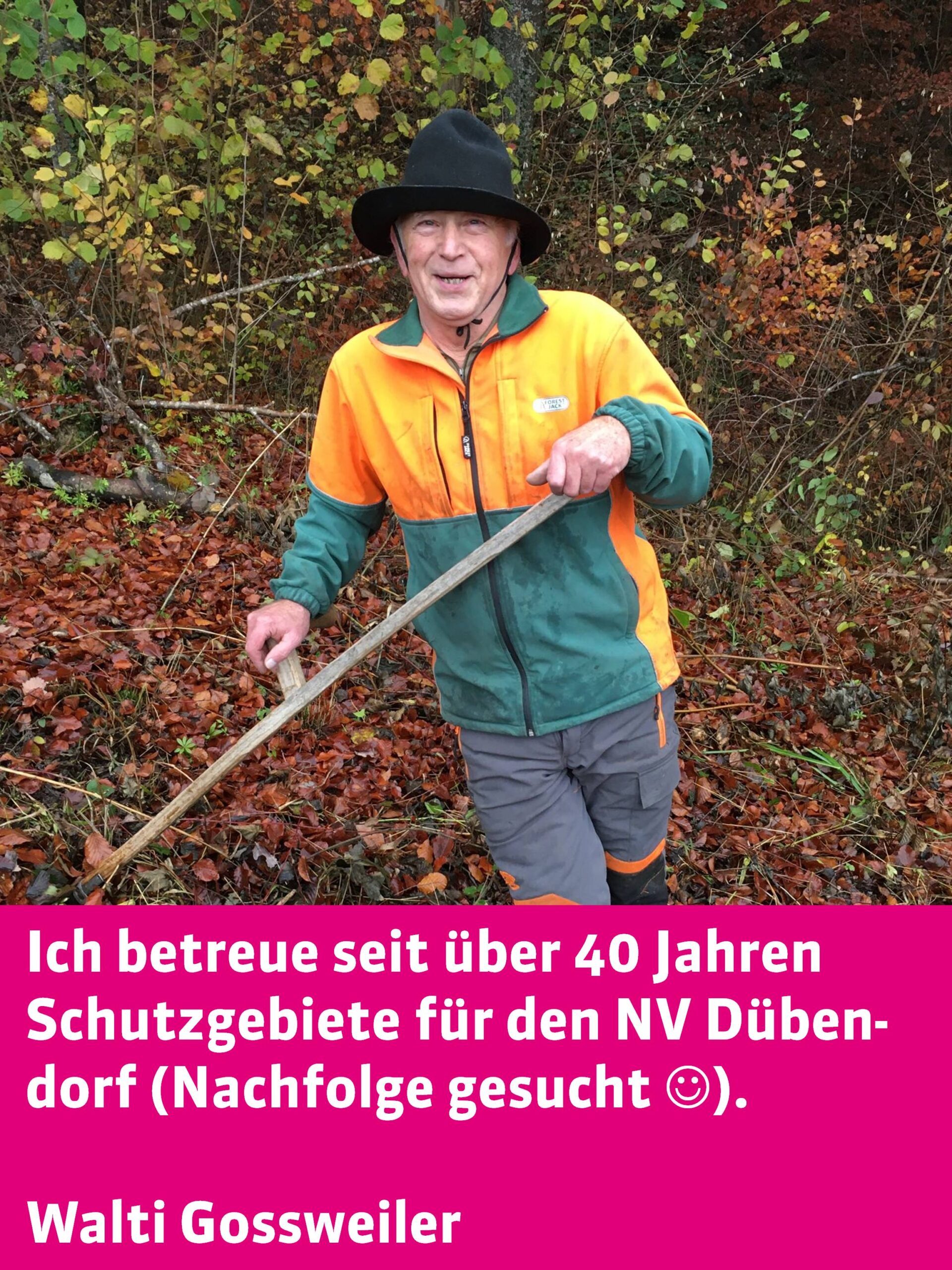

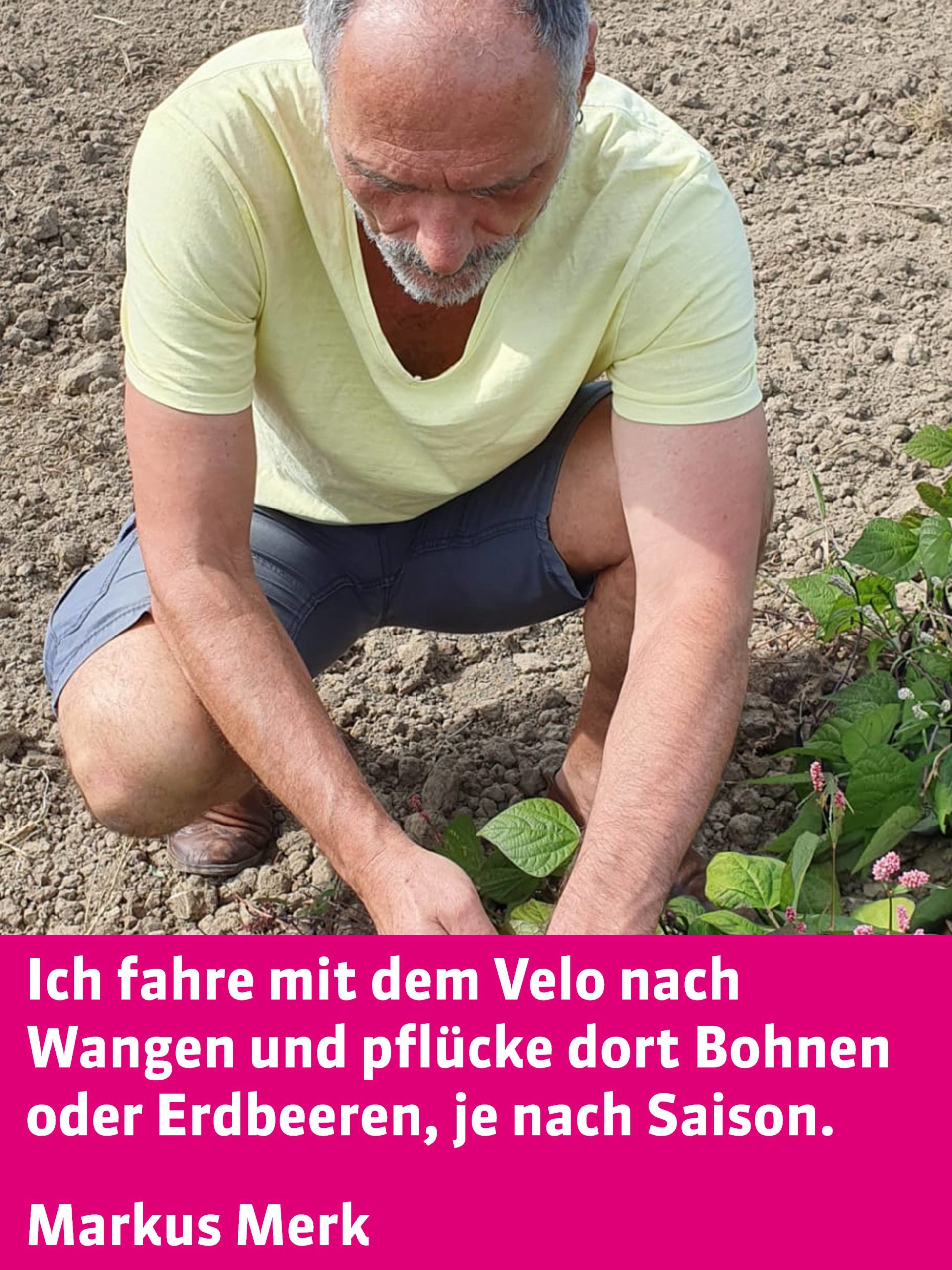





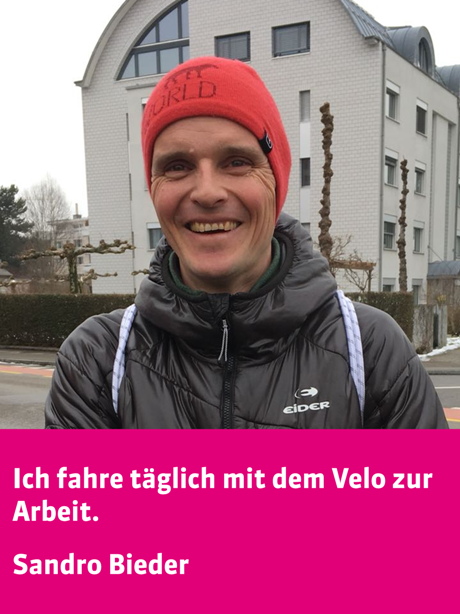










 RSS – Beiträge
RSS – Beiträge
Kommentar verfassen