Das Postulat wurde mit 19 zu 17 Stimmen aufrechterhalten.
Antwort des Stadtrats
Das Postulat Julian Croci und 11 Mitunterzeichnende „Treibhausgas-Emissionen Dübendorf“ wird wie folgt beantwortet:
Vorbemerkung
ln der vorliegenden Antwort wird die graue Energie von Bauten, des Konsums und der lmporte nicht berücksichtigt. Da auch erneuerbare Energieträger CO2-Faktoren aufweisen, wird der Begriff fossilfrei angewendet. Dies entspricht in etwa auch dem Begriff „netto-null“, wie ihn das Bundesamt für Umwelt beim territorialen Ansatz der CO2-Emissionsbilanzierung anwendet.
Aktueller Stand
Die Stadt Dübendorf ist seit 2002 als Energiestadt zertifiziert und erreichte bei der letzten Überprüfung (Re-Audit) 72% der möglichen Punkte. Die Stadt überwacht den Energieverbrauch und die Umweltauswirkungen, die sie über das gesamte Stadtgebiet alle vier Jahre im Umweltbericht zum Stand der Energieverbräuche und der Wasserqualität festhält. Mit jedem Re-Audit wird auch ein Energie-Politisches Programm verabschiedet, welches die Massnahmen der nächsten vier Jahre vorgibt, um den gesteckten Zielen näher zu kommen.
Die Stadt Dübendorf führt eine Energiebuchhaltung über die 15 energetisch wichtigsten eigenen Liegenschaften (ohne Schulgemeinde). lnsgesamt werden pro Jahr rund 1 GWh Wärme verbraucht (24% davon stammen aus erneuerbaren Quellen). Umgerechnet in Treibhausgasemissionen entspricht dies 368t CO2-Äquivalenten für die 15 wichtigsten Gebäude. Für sämtliche öffentliche Bauten (inkl. Schule) werden etwa 12 GWh/a Wärme verbraucht, was ca. 4% des Gesamtenergiebedarfs des Stadtgebiets entspricht.
Die Beschaffung in der Verwaltung erfolgt nach Vorgaben gemäss dem Qualitätsmanagement-System und berücksichtigt zahlreiche ökologische und soziale Zertifikate und Label.
Bereits sind einzelne städtische Fahrzeuge mit erneuerbaren Treibstoffen im Einsatz (Stadtpolizei und Glattwerk AG: E-Auto; Abteilung Tiefbau: Wasserstoff-Kehrfahrzeug). Die Stadtverwaltung hat zudem mit dem kantonalen Angebot „lmpuls Mobilität“ Massnahmen zur Optimierung der Mobilität in der Verwaltung ergriffen.
Die Glattwerk AG liefert den Haushalten 100% erneuerbaren Strom und hat sich im Gasvertrieb zum Ziel gesetzt, bis 2030 den Kunden 30% Biogas im Standardprodukt zu liefern.
Strategie netto null bis 2030 qemäss Postulat
Das Postulat fordert verbindliche Massnahmen, um in allen städtischen und stadtnahen Betrieben bis 2030 den Treibhausgas-Ausstoss von netto null zu erreichen. Bei den städtischen und stadtnahen Betrieben wird in dieser Antwort nur der Betrieb, nicht die vertriebenen Produkte betrachtet.
Handlungsbereiche
Die Handlungsbereiche und deren wichtigste Massnahmen sehen wie folgt aus:
- Gebäude
- Erstellung Sanierungskonzept mit Priorität Heizsystemersatz vor Bauteilalter
- Vorzeitiger Heizsystemersatz zur Umstellung auf erneuerbare Energieträger (10 Gebäude mit Ölheizungen)
- Einkauf CO2-neutrales Gas (27 Gebäude, plus Umrüstung von Heizöl auf Gas, vgl. Punkt oben)
- Elektrizität
- Einkauf von erneuerbarem Strom. Vorgabe: mind. nicht zertifizierte Wasserkraft aus der Schweiz
- Konsum/Geräte
- Überprüfung der Beschaffungsvorgaben: Anpassungen und Ergänzungen z.B. bezüglich fossil-betriebener Geräte und Fahrzeuge, Strom- und Gasbeschaffung.
- Umrüstung aller fossilbetriebener Arbeitsgeräte (Tiefbau, Liegenschaften, Stadtgärtnerei, etc.) auf Akkubetrieb
- Mobilität
- Umsetzung (und evtl. Ergänzung) Mobilitätskonzept für die Verwaltung
- Umrüstung der Fahrzeugflotte auf erneuerbaren Treibstoff (Elektro, Wasserstoff, Biogas)
Herausforderungen
Ein reiner Heizsystemersatz in einem bestehenden Haus ohne vorgängige energetische Sanierung ist nicht sinnvoll. Wird auf eine energetische Sanierung verzichtet, wird langfristig betrachtet eine zu gross dimensionierte Heizung installiert, was hinsichtlich der grauen Energie ineffizient ist. Gebäudesanierungen aber sind kostspielig und bedürfen einer mittel- bis langfristigen (Finanz-)Planung.
Der Markt an Fahrzeugen mit erneuerbarem Antriebsystem, insbesondere an Spezialfahrzeugen wie sie oft in Verwaltungsbetrieben benötigt werden, ist noch sehr klein bis inexistent. Man müsste in diesen Fällen allenfalls Prototypen erwerben und diese testen und weiterentwickeln, wie Dübendorf dies bereits mit dem Kehrfahrzeug (mit Wasserstoff betrieben) macht. Ein Austausch des gesamten Fahrzeugparks der städtischen Verwaltung ist in dieser kurzen Zeitspanne aber kaum zu erreichen.
Auswirkungen/Kostenschätzungen
Die Umsetzung des Postulats, bis 2030 CO2-Emission netto null in der Verwaltung und stadtnahen Betrieben zu erreichen, erfordert zusätzliche personelle und finanzielle Ressourcen. ln einem ersten Schritt soll gemäss Postulat eine Strategie erarbeitet werden, die in einem zweiten Schritt innert zehn Jahren umzusetzen ist.
Dazu werden folgende finanzielle Ressourcen geschätzt:
- Erarbeitung Strategie: CHF 15’000 – 20’000
- Umstellung 10 Gebäude von Heizöl auf Biogas, Holz od. Wärmepumpe: CHF 220’000 – 480’000
- Vorgängige Sanierung der 10 Gebäude: keine Abschätzung möglich
- Jährlicher Aufpreis CO2-neutraler Strom für alle Gebäude: CHF 6’000
- Jährlicher Aufpreis CO2-neutrales Gas für 27 bis 32 Gebäude: CHF 10’000 – 15’000
- Umrüstung/Ersatzbeschaffung Geräte (z.B. für Unterhalt Grünanlagen): keine Abschätzung möglich
- Ersatzbeschaffungen ca. 50 Benzin/Diesel Fahrzeuge: CHF 900’000 – 1’200’000
- Einsparung Treibstoffkosten: ca. 5 CHF/km
Die Kosten für die Umrüstungen (Fahrzeugbeschaffung, Heizsysteme, Geräte) fallen teilweise in den normalen Erneuerungszyklus.
Für Fahrzeuge wird von einem Erneuerungszyklus von 10-15 Jahren ausgegangen, womit ein grösserer Teil der Neuanschaffungen im ordentlichen Budget wird berücksichtigt werden können, allerdings nur unter der Voraussetzung, ein entsprechendes Fahrzeug ist bereits ohne fossilem Antriebsystem auf dem Markt.
Für Öl- und Gas-Heizungen gilt ein Erneuerungszyklus von 15-20 Jahren. ln diesem Bereich werden somit Mehraufwände erwartet, insbesondere auch weil eine vorgängige energetische Sanierung empfehlenswert ist. Die’intensivere Erneuerung des Liegenschaftenportfolios benötigt zudem erheblich mehr Personalaufwand. Da der Sanierungsstand der Liegenschaften für diese Antwort nicht im Detail erhoben wurde, ist eine Bezifferung des Aufwands nicht möglich.
Zwischenfazit
Die zweckmässige, vorgängige energetische Sanierung der Gebäude ist in der geforderten Zeit bis 2030 auch unter Aufwendung erheblicher finanzieller und personeller Ressourcen kaum erreichbar. lm Fahrzeugbereich scheint eine Zielerreichung im Bereich der Personenwagen möglich, bei den Spezialfahrzeugen ist die Zielerreichung stark von der Marktentwicklung abhängig.
lm Gebäude- und im Mobilitätsbereich ist das Ziel einer Umstellung auf „fossil-frei“ bis 2030 somit, falls überhaupt, nur mit erheblichem zusätzlichem finanziellem und personellem Aufwand erreichbar. Eine Umstellung bis 2040 erscheint realistisch machbar, da die ordentlichen Erneuerungszyklen berücksichtigt werden können. Allerdings müsste auch in diesem Fall die energetische Sanierungsplanung des Liegenschaftenportfolios erheblich beschleunigt werden und zusätzliche finanzielle und personelle Ressourcen bereitgestellt werden.
Selbst wenn das im Postulat geforderte Ziel vollständig erreicht würde, wären damit aber nur geschätzte 8% des Energiebedarfs des gesamten Stadtgebiets dekarbonisiert.
Alternativer Vorschlag
Da die Forderungen des Postulats nur schwer zu realisieren sind und nur einen geringen Teil der Treibhausgas-Emissionen auf dem Gebiet der Stadt Dübendorf umfassen, wird dem Gemeinderat im Rahmen der Postulatbeantwortung eine Alternative vorgeschlagen. Der Alternativvorschlag besteht aus zwei Elementen.
- Einerseits die Umsetzung einiger Sofortmassnahmen der städtischen Verwaltung, welche eine vergleichsweise geringe Kostenfolge haben, aber wirksam sind.
- Andererseits die Ausarbeitung eines „Massnahmenplan Klima“ über die diversen möglichen Handlungsfelder.
Sofortmassnahmen
ln die Beschaffungsvorgaben der Stadt Dübendorf und der städtischen Betriebe werden folgende Punkte aufgenommen:
- Bezug erneuerbarer Strom (mindestens Strom aus nicht-zertifizierter Wasserkraft aus der Schweiz)
- Bezug CO2-neutrales Gas („glattgas CO2-neutral“ bei der Glattwerk AG)
- Ersatzbeschaffungen bei Geräten und Fahrzeugen haben mit fossil-freier Betriebsenergie zu erfolgen, sofern ein leistungsmässig vergleichbares Produkt erhältlich ist.
- Sobald ein Heizsystemersatz ansteht, erfolgt dieser nur noch mit Umstellung auf einen fossilfreien Energieträger
- Die energetische Sanierung der Gebäude wild mit einem umfassenden Gebäude-Sanierungskonzept auf den Heizsystemersatz abgestimmt.
Die ersten beiden Massnahmen führen zu jährlichen Mehrkosten von CHF 15’000 – 20’000 gemäss obiger Schätzung. Die Ersatzbeschaffungen bei Geräten, Fahrzeugen und Heizsystemen verursachen keine oder nur geringe Mehrkosten, sofern diese erst am Ende der Lebensdauer der aktuell in Gebrauch stehenden Geräte/Fahrzeuge/Heizsysteme erfolgen. Die energetischen Sanierungen führen zu Mehrkosten, die jedoch aufgrund des tieferen Wärme- und Stromverbrauchs mittelfristig amortisiert werden.
Massnahmenplan Klima
Der Betrachtungsperimeter wird auf das gesamte Stadtgebiet ausgedehnt und ein umfassender „Massnahmenplan Klima“ erstellt. Den Überbau bildet die Anerkennung und Unterstützung der nationalen und internationalen Bestrebungen zum Klimaschutz, insbesondere das Übereinkommen von Paris, in welchem sich die internationale Staatengemeinschaft, darunter auch die Schweiz, dazu bekannt, die globale Erwärmung auf deutlich unter 2 ‚C zu begrenzen. Vor diesem Hintergrund sollen Bund, Kantone und Gemeinden ihre jeweiligen Möglichkeiten zur Verminderung der Treibhausgasemissionen nutzen und einen Beitrag zur Begrenzung des Klimawandels leisten. Für Wirtschaft und Private müssen geeignete Rahmenbedingungen geschaffen werden.
Der Massnahmenplan Klima ist ein Koordinations- und Controlling-lnstrument. Die Massnahmen und deren Wirkung sollen sich auf das gesamte Stadtgebiet erstrecken. Der Massnahmenplan Klima umfasst einerseits Massnahmen zur konkreten Emissionsverminderung, aber ebenso Massnahmen zur Anpassung an den Klimawandel.
Nach einer Bilanzierung der CO2-Emissionen und des Energieverbrauchs werden die Handlungsfelder genauer definiert, wobei auch das Energieversorgungsunternehmen einbezogen wird. Mögliche Handlungsfelder sind u.a.: Mobilität, Gebäude, Stadt- & Mikroklima, Ver-/Entsorgung, lnfrastruktur, Natur, Forst-/Landwirtschaft sowie flankierende Massnahmen. Anschliessend werden die Ziele und Prioritäten gesetzt, sowohl für das Stadtgebiet, als auch für die Verwaltung und Betriebe im Besitz der Stadt. Pro Handlungsfeld werden mit den zuständigen Verantwortlichen der Gemeinde die geeigneten Massnahmen erarbeitet. Der Zeithorizont der Zielerreichung bildet dabei spätestens das Jahr 2050. Auf diesen Grundlagen können die Massnahmen konkretisiert und deren Wirkung abgeschätzt werden. Die regelmässige Berichterstattung zu den getroffenen Massnahmen und deren Wirkung kann im alle 4 Jahre erscheinenden Umweltbericht der Stadt Dübendorf erfolgen.
Da erste Auswirkungen des Klimawandels bereits spürbar sind, nehmen – neben Massnahmen zur effektiven Verminderung des CO2-Ausstosses – die Vorkehrungen zur Anpassung an den Klimawandel an Bedeutung zu (insbesondere in den Handlungsfeldern Stadt-/Mikroklima und lnfrastruktur). Mit einem Massnahmenplan Klima würden auch diese Aspekte berücksichtigt und entsprechende Massnahmen entwickelt.
Der Massnahmenplan Klima hält in einem Bericht folgende Ergebnisse fest:
- Energie- und CO2-Bilanz,
- konkrete Zielsetzung inkl. Absenkpfad
- Massnahmenprogramm inkl. Zuständigkeiten, Kosten, Verweise auf bestehende Grundlagen und Monitoring
- lndikatoren entsprechend der Zielsetzung
Die Kosten zur Erarbeitung eines Massnahmenplans Klima werden auf CHF 50’000.- bis 70’000.- geschätzt. Die Kosten der Umsetzung sind schwer zu beziffern, da eine stadtspezifische Auslegeordnung noch fehlt. Im Massnahmenplan Klima werden die notwendigen Ressourcen (finanziell und personell) pro Massnahme abgeschätzt und ausgewiesen inkl. den Mehr-/Minderkosten, die bei der Umsetzung entstehen. Bei der Erarbeitung des Massnahmenplans sowie der Umsetzung kann die Kommission Energiestadt als Steuerungsgremium fungieren.
Ein Massnahmenplan Klima, bestehend aus einem Massnahmenplan zur Verminderung der Treibhausgase und einem Massnahmenplan Anpassung an den Klimawandel, existiert bereits auf kantonaler Ebene. Der Kanton Zürich hat unter Federführung des AWEL die zwei Massnahmenpläne erarbeitet und im September 2018 publiziert. Auch mehrere Zürcher Gemeinden haben Aktivitäten zur Erarbeitung eines solchen Massnahmenplans aufgenommen.
Fazit
Das im Postulat formulierte Ziel netto null resp. fossil-frei der stadteigenen Betriebe bis 2030, welches mit einer zu erarbeitenden Strategie umgesetzt werden soll, erscheint aufgrund der vorstehenden Ausführungen nicht zweckmässig. Trotzdem möchte der Stadtrat der grundsätzlichen Stossrichtung der Postulanten entsprechen. Dem Postulanten und den Mitunterzeichnenden wird deshalb vorgeschlagen, einen das gesamte Stadtgebiet umfassenden Massnahmenplan Klima gemäss den vorstehenden Ausführungen ausarbeiten zu lassen. Dieser hat einen längeren Zeithorizont (bis 2050) als die von den Postulanten vorgeschlagene Strategie, umfasst dafür aber wesentlich mehr Handlungsfelder, weshalb in absoluten Zahlen auch eine deutlich höhere Reduktion der Treibhausgasemissionen erreicht werden dürfte. Da die Treibhausgas-Emissionen der stadteigenen Betriebe ein wichtiges Handlungsfeld des Massnahmenplans Klima sein werden, kann davon ausgegangen werden, dass im Zeitraum zwischen 2040 und 2050 das Ziel „netto null“ für die stadteigenen Betriebe erreicht wird. Voraussetzung für die Umsetzung der Sofortmassnahmen sowie die Ausarbeitung des Massnahmenplans Klima ist die Aufrechterhaltung des Postulats durch den Gemeinderat.
lm Sinne der vorstehenden Ausführungen wird dem Gemeinderat beantragt, das Postulat „Treibhausgas-Emissionen Dübendorf “ aufrecht zu halten.
Stellungnahme Grüne
Zuerst einmal möchte ich mich für die Bearbeitung des Postulats beim Stadtrat und der Verwaltung bedanken. Grundsätzlich sind wir zufrieden und einverstanden mit dem Vorgehen, welches der Stadtrat vorschlägt. Allerdings möchten wir doch zwei Punkte noch kommentieren.
In der Antwort wird auf die stadteigenen Gebäude eingegangen und welche Möglichkeiten bestehen, diese einigermassen Klimatauglich zu machen. Eine weitere naheliegende Massnahme für die Energiewende im Kontext von Gebäuden wäre das Installieren von Photovoltaik Anlagen. Aus der penetranten Abwesenheit der Solarenergie in der Beantwortung als auch im Umweltbericht der Stadt könnte man schliessen, dass die Sonne in Dübendorf nie scheint.
Weder das Wort «Solar» noch «Photovoltaik» kommen in der Antwort vor. Sucht man die beiden Begriffe auf der Website der Stadt Dübendorf, bekommt man genau drei Einträge, wenn man nur innerhalb der Website sucht: Einen Firmen Eintrag, den Eintrag zur Grünen Partei und Werbung für eine App, die einem unkompliziert sagen soll, wie hoch die Rendite auf einem Dach ausfällt, sollte man eine Photovoltaik Anlage installieren. Ebenfalls findet Photovoltaik nicht statt im Umweltbericht der Stadt Dübendorf.
Vor sieben Jahren wurde bereits ein Postulat bezüglich Solarenergie an den Stadtrat überwiesen. In der Beantwortung wird darüber lamentiert, dass sich die meisten stadteigenen Gebäude nicht für Photovoltaik eignen würden. Wir erwarten, dass der Stadtrat sich dem Thema im Massnahmenplan Klima der Thematik nochmals annimmt.
Weiter scheint der Stadtrat einen grossen Fokus auf Biogas zu setzen. Grundsätzlich ist dies verständlich. In Dübendorf gibt es bereits ein Gasnetz, welches es vermutlich einfach macht, neue Gebäude anzuschliessen. Leider müssen wir die Euphorie hier aber bremsen. Selbst wenn die Schweiz ihr Biogas-Potenzial komplett ausnützen würde, könnte dies nur ein Neuntel des heutigen Erdgasbedarfs decken. Der Ersatz von Ölheizungen mit Gasheizungen ist folglich keine nachhaltige Lösung und sollte nicht als solche präsentiert werden, weil schlicht zu wenig Biogas produziert werden kann. Selbstverständlich ist hingegen, dass der Betrieb bereits existierender Gasheizungen mit Biogas sinnvoll ist, nur ist dies in den wenigsten Fällen eine langfristige Lösung.
Zu guter Letzt möchten wir auch noch auf ein planerisches Werkzeug hinweisen, nämlich die so genannten Energiezonen. Diese ermöglichen seit 2015 den Gemeinden im Rahmen der Bau- und Zonenordnung Gebiete festzulegen, auf welchen verstärkt erneuerbare Energien zum Zug kommen sollen. Insbesondere im Zusammenhang mit der laufenden Ortsplanungsrevision sollte diese Möglichkeit in Betracht gezogen werden.
Julian Croci, Gemeinderat Grüne



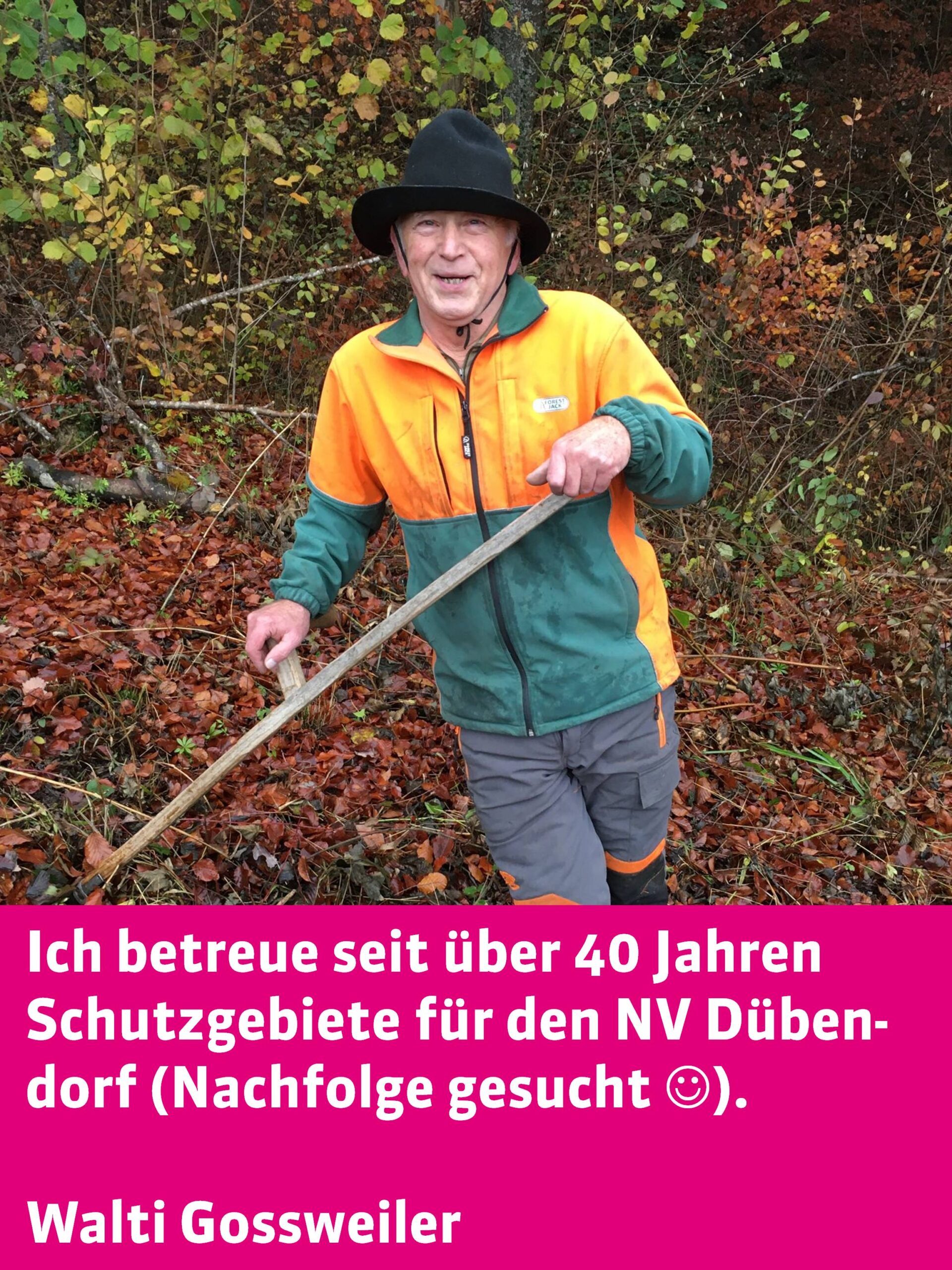

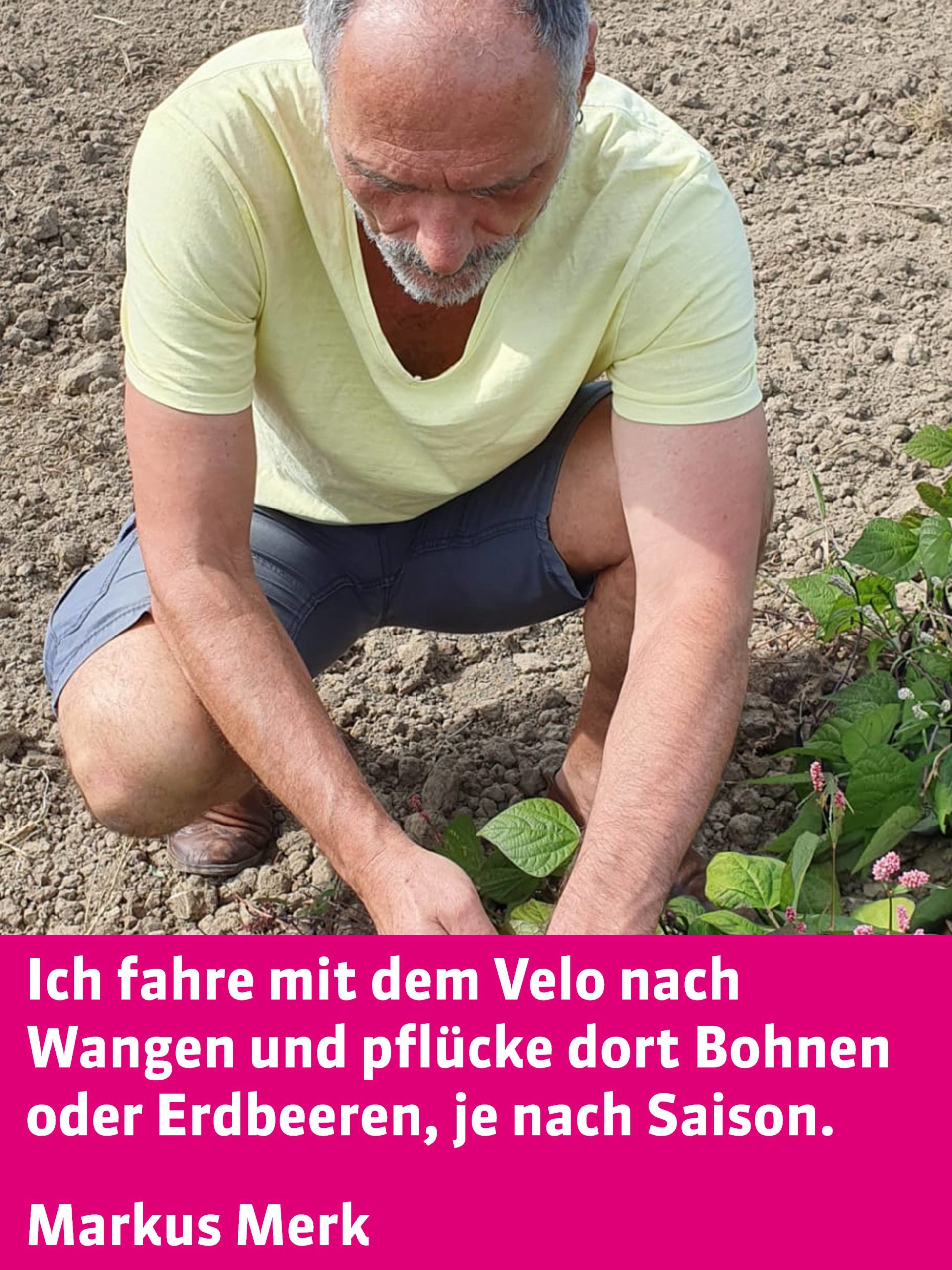





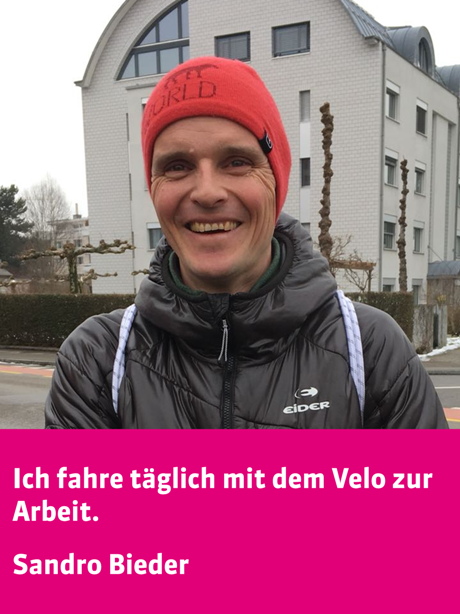










 RSS – Beiträge
RSS – Beiträge
Kommentar verfassen